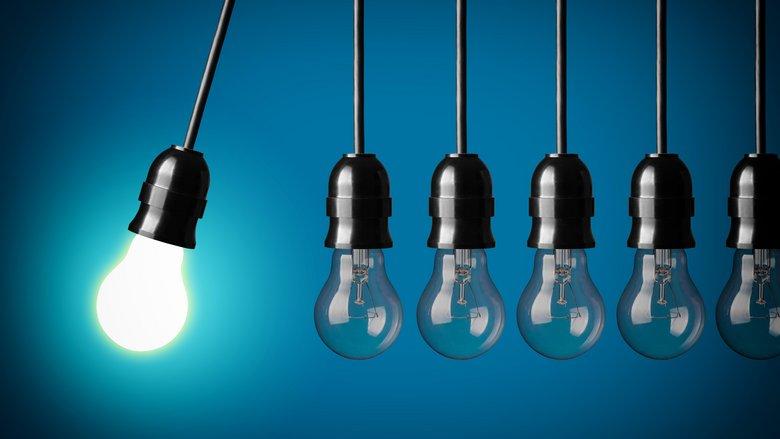Deutsche Unternehmen sind innovationsmüde
"Unsere Leitindustrien sind nicht mehr Schrittmacher,” konstatierte kürzlich die renommierte Beratungsgesellschaft Accenture in einer Studie. Wir werden "ohne Geschäftsmodellinnovation vom Leitanbieter zum Zulieferer”, heißt es dort weiter. Jedoch sind explizit Unternehmen, die auf die Digitalisierung setzen, wie Wirecard und Zalando, nicht von der Wachstumsschwäche betroffen und konnten in den vergangenen Jahren ordentliche Wachstumsraten aufweisen. Bei Themen wie Elektromobilität und Cloud-Lösungen haben deutsche Unternehmen jedoch offenbar den Anschluss verloren – zumindest vorübergehend.
Die Lösung geht mit dem Fachbegriff "Coopetition” einher. Er verbindet die beiden englischen Wörter "Cooperation” und "Competition” und beschreibt eine Art der Zusammenarbeit zwischen konkurrierenden Unternehmen. Das erscheint auf ersten Blick widersprüchlich. Wenn hiesige Unternehmen jedoch vorankommen wollen, müssen sie trotz Konkurrenz in einigen Bereichen die knappen Ressourcen besser bündeln und gemeinsam nutzen – oder auch mit Start-ups zusammenarbeiten. Eine Partnerschaft ermöglicht es, Daten zu bündeln sowie mehr Wachstums- und Wertschöpfungsperspektiven zu schaffen.
Lesen Sie auch: MDax – Wie Anleger am deutschen Mittelstand partizipieren
Wertewandel in den Chefetagen notwendig
Für eine erfolgreiche Umsetzung ist jedoch ein grundlegender Wertewandel und ein anderes Kulturverständnis notwendig. Hierzulande herrscht noch immer oft ein sogenanntes Silodenken vor: Wissen wird zu oft für sich behalten, anstatt es mit anderen zu teilen. Das erschwert oftmals neue Partnerschaften oder verhindert sie sogar.
"Vor allem wenn man in Richtung Asien oder in Richtung der USA sieht, hinken deutsche Familienunternehmen hinterher. Das gilt insbesondere für den B2C-Bereich – hier gibt es kaum innovative, digitale Ansätze in Deutschland”, resümiert Nadine Kammerlander, Inhaberin des Lehrstuhls für Familienunternehmen an der WHU-Otto Beisheim School of Management.
Wie wichtig die Vernetzung ist, zeigt auch die Einweihung des Berliner "Maschinenraums". Auf einer umgebauten Fläche von 4.500 Quadratmetern können sich dort in Zukunft kleine und mittlere Unternehmen vernetzen, die die Digitalisierung in ihre Geschäftsmodelle schneller voranbringen wollen.
Das kostet zwar etwas: Der Preis für die Jahresmitgliedschaft beträgt zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Innovationen sind aber nun mal nicht umsonst zu haben. Kontakte in der Wirtschaft sowieso nicht. Gefordert ist also nicht nur eine reine Digitalisierung von analogen Prozessen, etwa bei der Verarbeitung von Lieferscheinen oder Rechnungen. Auch Vernetzung und Kooperation ist notwendig.
Lesen Sie auch: Die besten Dividenden im Dax und MDax
Die Stiftung "digital age" befasst sich mit allen Belangen rund um das neue digitale Leben und veröffentlichte nun eine neue Studie zum Thema Digitalisierung. Sie misst die digitale Kompetenz in Deutschland. Das Ergebnis dabei ist erschreckend niedrig. Die Studie kommt in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Guido Ellert zu einem Digitalisierungswert von 61 von maximal 100 möglichen Punkten. Dabei liegt Deutschland vor Frankreich (57 Punkte) und nur knapp hinter den Nachbarn aus der Schweiz (63) und den USA (65 Punkte).
Der Index setzt sich dabei aus drei Einzelkategorien zusammen: Der Anwendungskompetenz, der Entscheidungskompetenz und der Gestaltungskompetenz. Allgemein stellt die Studie ein ausgeprägtes Nord-Süd Gefälle und ein geringes West-Ost Gefälle fest. Während Bayern als Primus auf 73 Punkte kommt, erhält Niedersachsen 55 und das Saarland sogar nur 46 Punkte.
Lesen Sie auch: Familienunternehmen – Corona-Rücksetzer bieten Chancen
Wie Unternehmen "digitaler” werden
Eine Studie der Beratungsgesellschaft Deloitte stellt fest, dass sich digital erfolgreiche Unternehmen in der Schweiz insbesondere durch folgende Eigenschaften auszeichnen:
- Agilität
- flache Hierarchien
- kurze Wege
- Effizienz
- digitale Vernetzung
- Weiterbildung der Mitarbeiter / Mitarbeitermanagement
Agile Unternehmen verstehen, in welche Richtung sich Märkte bewegen und haben interne Prozesse etabliert, die schneller funktionieren als bei der Konkurrenz. Wirtschaftsprofessorin Nadine Kammerlander sieht noch weitere Punkte die bei einer erfolgreichen Digitalstrategie entscheidend seien können:
- Die Digitalstrategie entwickeln und klar kommunizieren. Digitalisierung muss "gesteuert" werden, jeder im Unternehmen muss das gleiche Verständnis von Digitalisierung haben.
- Kommunikation von Zwischen-Ergebnissen. Digitalisierung ist ein langwieriger Prozess, der oft Misserfolge und Rückschritte einschließt. Die Motivation der Mitarbeiter hoch zu halten ist eine Kern-Herausforderung. Die Kommunikation von "Erfolgsstorys" kann dabei helfen.
- Kooperation mit Start-ups. Insbesondere bei radikalen Innovationen tun sich Familienunternehmen schwer in der Entwicklung und Umsetzung.
Wenn Unternehmen erfolgreich eine Digitalstrategie etablieren und alte Strukturen bei Seite schaffen, sind neue Innovation wieder (eher) möglich. Und ganz so einfach wollen sich die die Unternehmen in Deutschland noch nicht abhängen lassen.
Einen großen Schritt in die richtige Richtung machten jedenfalls vor einigen Wochen ausgerechnet die großen deutschen Autobauer Daimler, Volkswagen und BMW, den man in den vergangenen Jahren Innovationsmüdigkeit vorgeworfen hat: Sie wollen gemeinsam ein eigenes Betriebssystem als Alternative zu Google und Apple entwickeln.