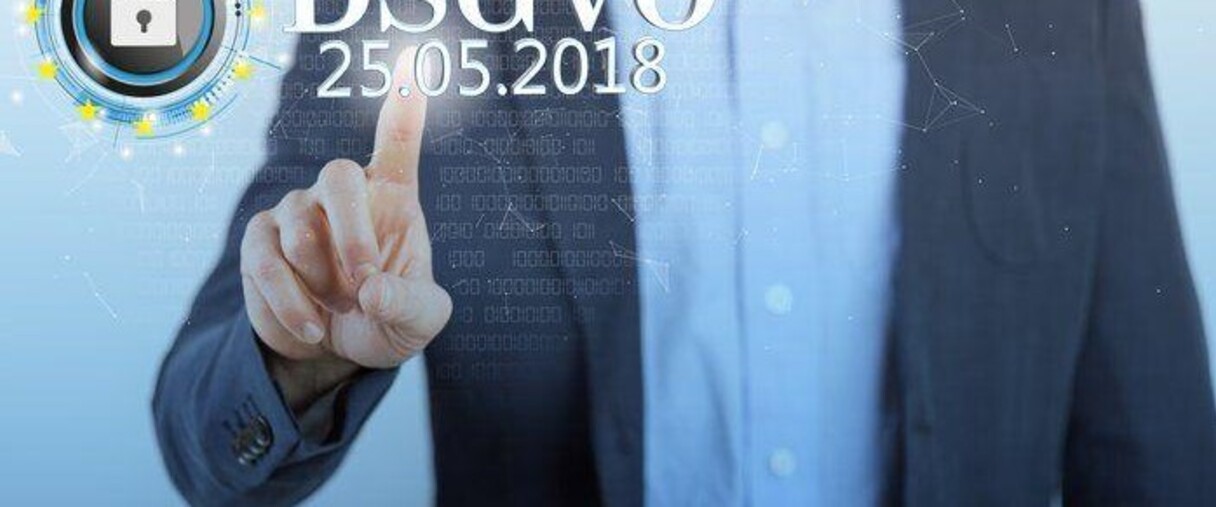Nach dem Willen der EU sollen Verbraucher künftig die Hoheit über ihre Daten selbst in der Hand halten. Vor allem sollen sie bestimmen können, was damit geschieht. So ist das Speichern von Daten ab 25. Mai 2018 nur noch dann erlaubt, wenn Verbraucher dem zustimmen oder wenn das Gesetz dies explizit erlaubt. Damit kommt auch auf Vermieter einige Arbeit zu. Die wichtigsten Punkte im Überblick:
Datenspeicherung nur mit Zustimmung des Mietinteressenten
Vor der Vermietung einer Wohnung steht die Wohnungsbesichtigung. Gefällt einem Interessenten das Objekt und möchte er sich um die Wohnung bewerben, muss er in der Regel einen Auskunftsbogen ausfüllen. Neu ist: Die hierbei erhobenen Daten wie Adresse, Telefonnummer oder Schufa-Auskunft darf der Vermieter nur mit Einwilligung des Mietinteressenten speichern. Dazu zählt nachfolgend auch ein möglicher E-Mail-Verkehr, erbrachte Gehaltsnachweise und ähnliches. Der Interessent kann der Speicherung seiner Daten jederzeit widersprechen. In diesem Fall muss der Vermieter die Daten löschen.
Kommt das Mietverhältnis zustande, sieht die Sache anders aus. Dann ist der Vermieter verpflichtet, die für den Mietvertrag erforderlichen Daten einzuholen und für die Dauer des Mietverhältnisses zu speichern. Hiergegen kann der Mieter nicht widersprechen.