
 Schweden
Schweden- Basiszins: 1,96%
- Aktionszins: 2,76% - gültig bis 15.08.2025

 Deutschland
Deutschland- Basiszins: 0,75%
- Aktionszins: 2,75% - gültig bis 13.01.2026

 Deutschland
Deutschland- Basiszins: 2,00%
- Aktionszins: 2,60% - gültig bis 30.09.2025
Auf einen Blick
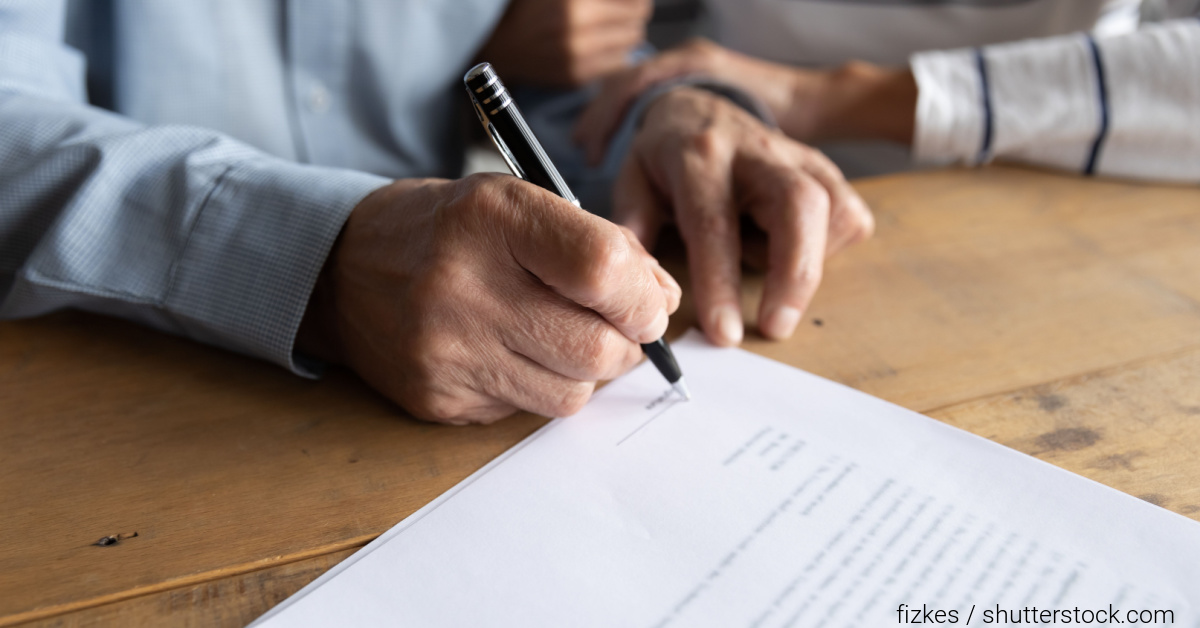

Das deutsche Erbrecht ist komplex und voller Überraschungen. Da können unerwartet entfernteste Verwandte einen Anteil erben, zerstrittene Familienmitglieder erben gemeinsam eine Immobilie und müssen sich einigen, unverheiratete Paare beerben sich untereinander gar nicht, bei Alleinstehenden erbt unter Umständen der Staat und in vielen Fällen wird erbittert um den Hausstand gestritten. Die Lösung ist ein Testament. Mit diesem Schriftstück können Sie die Nachlassübergabe individuell gestalten und den Angehörigen in vielen Fällen Streit ersparen.
Wie Sie ein Testament verfassen, bei welchen Familienkonstellationen es besonders ratsam ist, welche Formen eines Testaments es gibt und wann juristischer Beistand ratsam ist.
Sie möchten keine Neuigkeiten aus dem Bereich Finanzen, Geldanlage und Vorsorge verpassen? Dann abonnieren Sie doch unseren kostenfreien Newsletter und bleiben Sie immer auf dem Laufenden.
Hat ein Verstorbener weder ein Testament noch einen Erbvertrag hinterlassen oder sind diese Schriftstücke formal unwirksam, gilt automatisch die gesetzliche Erbfolge.
Nach dieser erben Verwandte des Verstorbenen sowie Ehegatten und eingetragene Lebenspartner. „Dagegen kommen Patchwork-Konstellationen mit Stiefkindern, nicht verheiratete Partner oder Freunde in der Erbfolge gar nicht vor“, sagt die auf Erbrecht spezialisierte Rechtsanwältin Gesa Modersohn. Zudem wird der Nachlass immer anteilig unter den Erben aufgeteilt. Eine Immobilie muss dann vielleicht verkauft werden, damit die Erben ausgezahlt werden können. Wer das vermeiden möchte, muss ein Testament anfertigen. „Das ist für jeden ratsam, insbesondere dann, wenn Hinterbliebene abzusichern sind“, erklärt Modersohn.
Ihre Erben erhalten nach Ihrem Tod Ihr gesamtes Vermögen. Dazu gehören unter anderem Bargeld, Wertpapiere, Schmuck, eine Immobilie und auch Hausrat und andere materielle Güter. Auch Schulden werden vererbt, Erben müssen sich um die gesamte Nachlassabwicklung von der Verteilung des Erbes bis hin zur Auflösung von Verträgen kümmern. Sie sind auch für Ihre Bestattung zuständig. Erben kümmern sich ebenso um Ihren digitalen Nachlass, etwa um Ihre E-Mail-Konten und Ihre Konten auf Social-Media-Kanälen. In Kürze: Erben treten nach Ihrem Tod in die vererbbaren Rechtsbeziehungen ein.
Ein Testament ist in Juristensprache eine „einseitig getroffene Verfügung von Todes wegen“. Ein Testament ermöglicht eine individuelle Gestaltung der Nachlassübergabe. Es hebelt die gesetzliche Erbfolge aus. Sie können als Testamentsverfasser oder -verfasserin frei bestimmen, wer Ihr Vermögen erben soll, Sie können dabei auch Personen bedenken, mit denen Sie nicht verwandt sind, etwa Freunde oder auch einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin. Sie können auch mehrere Erben einsetzen.
Sie können auch ein minderjähriges Kind gezielt zum Erben einsetzen. Den Zugriff auf das Erbe hat es jedoch erst mit dem 18. Geburtstag. Denn so lange ist das Kind nicht voll geschäftsfähig. Stattdessen tragen die Eltern automatisch die Vermögenssorge. Sie verwalten gemeinsam als Stellvertreter für das Kind das Erbe, auch wenn sie geschieden sind. Allerdings kommen auch andere Personen für diese Aufgabe infrage, wenn der Erblasser etwa bewusst nicht möchte, dass die Eltern das Vermögen verwalten.
Wird im Testament ein Abkömmling, also ein Kind, ein Adoptivkind oder ein Enkel, ein Ehegatte oder ein Elternteil enterbt oder zu gering bedacht, kann den Betroffenen ein gesetzlicher Pflichtteil zustehen. Allerdings kommt es nur ausnahmsweise vor, dass Eltern und Enkeln Pflichtteile zustehen. So sind Enkel nur pflichtteilsberechtigt, wenn die Kinder bereits vorverstorben sind, Eltern sind nur pflichtteilsberechtigt, wenn der Erblasser keine Abkömmlinge hinterlassen hat. Die Höhe des Pflichtteils beträgt aber nur die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Es ist immer ein Geldanspruch. Pflichtteilsberechtigte haben grundsätzlich kein Recht auf bestimmte Gegenstände aus dem Nachlass und kein Mitspracherecht, was mit dem Vermögen geschieht.
Im Testament können Sie auch einen Testamentsvollstrecker benennen, der sich darum kümmert, dass das Testament vollzogen wird. Er nimmt den Nachlass in Besitz und hat die Verfügungsberechtigung, etwa über Konten und Immobilien. Diese Person sollte das volle Vertrauen des Erblassers besitzen. Sie könnten auch einen Notar oder einen Rechtsanwalt mit der Aufgabe betrauen. In den meisten Fällen ist ein Testamentsvollstrecker jedoch nicht nötig und die Funktion kann auch störend sein, etwa wenn sich die Person nicht engagiert genug um den Nachlass kümmert. In anderen Situationen ist es durchaus ratsam, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen, etwa wenn minderjährige Kinder zu Erben werden, die ja bislang nicht selbst über den Nachlass verfügen können. Ein Testamentsvollstrecker muss allerdings bezahlt werden. Ihm steht eine Vergütung zu, in der Regel zwischen 1,5 und vier Prozent aus dem Nachlasswert.
Biallo-Tipp: Mit einem Testament allein ist es jedoch in der Regel noch nicht getan, um allen Zwistigkeiten und Ränkespielen einen Riegel vorzuschieben. Um das Erbe zu sichern, den Nachlass zu sichern und den letzten Willen zu schützen gibt es zwei Möglichkeiten: die Testamentsvollstreckung und die Nachlasspflegschaft. Beide Varianten verfolgen unterschiedliche Ziele und sind folglich jeweils von anderen Voraussetzungen abhängig.
Niemand muss ein Testament verfassen. Die gesetzliche Erbfolge regelt, wem etwas zusteht. Es gibt sicherlich Konstellationen, bei denen man mit der gesetzlichen Erbfolge einverstanden ist. Viele meinen, ein Testament sei nur nötig, wenn man ein großes Vermögen zu vererben hat. Das ist ein Irrtum. Auch, wenn der Nachlass im Wert gering ist oder vielleicht nur aus einer einzigen Immobilie besteht, ist ein Testament wichtig. Sie können damit sicherstellen, dass Ihre Hinterbliebenen versorgt sind oder ganz gezielt Personen finanziell oder materiell abgesichert werden, die es möglicherweise über die gesetzliche Erbfolge nicht wären. Wer also die Nachlassübergabe gestalten und dirigieren möchte, wer was bekommt und wer wofür zuständig ist, sollte ein Testament verfassen. Dies kann aus verschiedenen Gründen ratsam sein.
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie ein Testament verfassen sollten, spielen Sie in Gedanken doch mal durch, wer Sie beerben würde und zu welchen Teilen, wenn die gesetzliche Erbfolge gilt. Wenn Sie damit einverstanden sind, brauchen Sie kein Testament. Ansonsten sollten Sie ein Testament verfassen. Lesen Sie dazu auch den Biallo-Ratgeber „Erbrecht Kinder: Was gilt für minderjährige Erben“.
Im deutschen Recht ist die Erbfolge weitverzweigt. Es erben unter Umständen auch noch weit entfernte Cousins, Cousinen oder andere ferne Verwandte. Wer zum Beispiel keinen Kontakt mit seiner Verwandtschaft hat oder in einer Patchworkfamilie lebt, kann durch ein Testament steuern, wer zum Erben wird. Mit einem Testament können Sie gezielt Personen enterben oder ganz gezielt Personen als Erben einsetzen. Allerdings müssen Sie Pflichtteilsansprüche beachten.
Eine Erbschaft führt häufig zu Streit und gar zu Zerwürfnissen in Familien. Ein Testament kann friedensstiftend sein. Die Wünsche des Erblassers können den Hinterbliebenen eine wichtige Leitplanke bieten, etwa Wertgegenstände wie wenn Gegenstände aus dem Hausrat – Möbelstücke, Immobilien, aber auch ideelle Werte – ganz gezielt verteilt werden. So können Sie zum Beispiel auch Teilungsanordnungen im Testament verankern: Kind A erbt das Haus, Kind B erhält Wertpapiere und Barvermögen. So müssen sich die Kinder nicht einigen, was mit der Immobilie passiert. Vor allem in Patchworkfamilien kann ein Testament Klarheit schaffen und Gerechtigkeit, denn Patchworkfamilien beerben sich untereinander zum Teil gar nicht oder es werden Personen plötzlich zu Erben, was man als ungerecht empfindet.
Ein weiterer guter Grund, ein Testament zu verfassen, ist, dass Sie Ihre Erben finanziell absichern wollen. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Immobilie zu vererben. Vielleicht möchten Sie sichergehen, dass die Immobilie für Ihren Ehepartner erhalten bleibt, solange dieser darin wohnt und dass etwa Kinder oder andere Erben erst später einen Anteil erben. Ist nichts geregelt, kann es zum Verkauf der Immobilie kommen, weil der Ehepartner die anderen Erben nicht auszahlen kann.
Wenn mehrere Personen zu Erben werden, bilden sie eine Erbengemeinschaft. Diese Gemeinschaften sind sehr streitanfällig, weil alle Entscheidungen gemeinsam getroffen werden müssen – etwa, was mit einer Immobilie geschieht. Die Erben dürfen alle mitreden – unabhängig davon, wie groß ihr Erbanteil ist. So kann es passieren, dass die Ehefrau sich plötzlich mit der Schwiegermutter oder mit einer Cousine des Verstorbenen auseinandersetzen muss, zu denen es im bisherigen Leben wenig Kontakt gab. Das kann man mit einem Testament umgehen. In einem Testament können Sie beispielsweise einen Haupterben einsetzen und andere Personen, die etwas aus dem Nachlass erhalten sollen, mit einem sogenannten Vermächtnis bedenken. So erhalten sie einen Anteil vom Erbe, aber haben kein Mitspracherecht und werden nicht zu Erben.
Junge Familien denken meist nicht daran, ein Testament zu verfassen. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, denn in einem Testament kann man auch die Sorge für die Kinder regeln, sollte den Eltern etwas zustoßen. So können Eltern mit minderjährigen Kindern dem Testament eine Sorgerechtsverfügung anfügen und so bestimmen, auf wen das Sorgerecht übergehen soll, wenn die Eltern sterben. Hat man nichts zu vererben, kann die Sorgerechtsverfügung auch alleiniger Inhalt des Testaments sein.
Es gibt gute Gründe, eine Immobilie zu vererben und nicht zu verschenken. Dann so behalten Sie als Erblasser oder Erblasserin Flexibilität und finanzielle Freiheit. Wie Sie mit einem Testament oder einem Vermächtnis bereits zu Lebzeiten vorsorgen und künftigen Streit um die Immobilien-Erbschaft im Vorfeld vermeiden. Lesen Sie dazu einen weiteren Ratgeber auf biallo.de.
Ein Testament ist handschriftlich zu verfassen, mit Datum, Ort und Unterschrift zu versehen. Formulieren Sie als Überschrift „Mein Testament“, damit ganz eindeutig ist, um welches Schriftstück es sich handelt.
Sie können ein handschriftliches Testament verfassen oder ein notarielles, „beide Formen sind gleichbedeutend“, sagt Rechtsanwältin Modersohn. Man muss also nicht zwingend zur Notarin oder zum Notar gehen, um ein Testament zu verfassen. Allerdings kann es sinnvoll sein. Denn ein notariell beurkundetes Testament kann einen Erbschein ersetzen. Das spart den Erben Geld und Zeit, denn ein Erbschein kostet Gebühren – in der Regel mehr, als der Notar verlangt – und es dauert oft Wochen, bis der Schein ausgestellt ist. Mit einem notariellen Testament sind die Erben häufig sofort handlungsfähig, können Verträge für den Verstorbenen oder die Verstorbene abwickeln und haben Zugriff auf das Bankkonto. Der Notar kann beraten und entwirft auch auf Wunsch einen Text, er stellt sicher, dass das Testament rechtswirksam ist.
Die Kosten einer Beurkundung richten sich nach dem Geschäftswert.
Testament notarielle Beurkundung & Notar Kosten:
| Geschäftswert* in EUR | Gebühren Einzeltestament in EUR | Gebühren gemeinschaftliches Testament in EUR |
|---|---|---|
| 10.000 | 75 | 150 |
| 25.000 | 115 | 230 |
| 50.000 | 165 | 330 |
| 250.000 | 535 | 1.070 |
| 500.000 | 935 | 1.870 |
*Der Geschäftswert orientiert sich am vorhandenen Vermögen. Beim Testament richtet sich der Geschäftswert nach dem Reinvermögen (Gesamtvermögen abzüglich Verbindlichkeiten wie Immobilienkredite, maximal bis zur Hälfte des vorhandenen Vermögens).
Quelle: Biallo.de/Notariat Regen
Wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie Ihr Testament gestalten sollen, sodass Ihre Wünsche auch juristisch gültig sind, kann auch eine Fachanwältin oder einen Fachanwalt für Erbrecht aufgesucht werden. Zumindest eine Erstberatung ist zu empfehlen, um auszuloten, auf welche Punkte man genau achten muss: Steuerfreibeträge, Pflichtteilsansprüche etc. Eine Anwältin oder ein Anwalt kann Sie etwa beraten, ob eine Schenkung angebracht wäre, um nach dem Tod Erbschaftsteuer zu vermeiden oder welche Klauseln im Testament sinnvoll sind und ob Formulierungen juristisch einwandfrei sind. Ein Gang zum Anwalt kann so späteren Unklarheiten vorbeugen: Oftmals formuliert man etwas, was später Fragen aufwirft – wie hat der Erblasser es genau gemeint?
Eine Erstberatung beim Fachanwalt kostet häufig nur rund 200 Euro. Wenn Sie dann eine intensivere Beratung wünschen oder der Anwalt oder die Anwältin das Testament für Sie aufsetzen soll, greift entweder das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – das Honorar richtet sich dann nach dem Vermögen – oder er oder sie rechnet nach Stundenhonorar oder mit einem Pauschalhonorar ab. Welches Modell greift, wird im Vorfeld abgesprochen.
Ein Testament ist nur gut, wenn es nach dem Tod auch gefunden wird. Nur so kann der letzte Wille Beachtung finden. Das Mindeste ist, dass das Testament mit anderen persönlichen Unterlagen aufbewahrt wird, zu denen die Hinterbliebenen Zugang haben. Hierfür eigenet sich zum Beispiel ein Notfallordner, den Sie selbst anlegen können und in dem Sie alle wichtigen Dokumente aufbewahren.
Am sichersten ist jedoch die amtliche Verwahrung beim Amts- oder Nachlassgericht. Das Gericht stellt einen Hinterlegungsschein aus, der bestätigt, dass ein Testament vorliegt. Außerdem wird das hinterlegte Schriftstück im Zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer erfasst. Den Hinterlegungsschein können Sie bei den persönlichen Unterlagen verwahren. Die amtliche Verwahrung beim Nachlassgericht kostet pauschal 75 Euro, für die Registrierung im Zentralen Testamentsregister fallen noch einmal 12,50 Euro beziehungsweise 15,50 Euro an. Wenn Sie Ihr Testament bei einem Notar haben beurkunden lassen oder es bei Gericht verwahren lassen, wird die Registrierung automatisch veranlasst.
Eine amtliche Verwahrung beugt auch dem Verdacht der Fälschung vor. Nicht selten geschieht es, dass Angehörige anzweifeln, dass ein Testament echt ist. Ein gefälschtes Testament wird aber kaum vom Erblasser beim Nachlassgericht abgegeben werden.
Übrigens: Wer ein Testament findet, ist verpflichtet, es unverzüglich dem Nachlassgericht, dem Amtsgericht des Wohnortes des Verstorbenen, auszuhändigen. Wer das unterlässt, riskiert eine Strafe.

 Schweden
Schweden
 Deutschland
Deutschland
 Deutschland
Deutschland
Sie können Ihr Testament jederzeit ändern oder widerrufen. Denken Sie aber daran, das veraltete Testament dann zu vernichten, es kann sonst Verwirrung stiften. Nicht selten haben Anwälte die Aufgabe, mehrere Versionen eines Testaments auseinander zu tüfteln. Auch unter Erben können verschiedene Versionen zu Streit führen – etwa, wenn diese sich fragen, warum ein Wille rückgängig gemacht wurde oder wie ein unklar formuliertes Testament auszulegen ist. Um eine ältere Version des Testaments zu widerrufen, müssen Sie Ihr Testament aus der amtlichen Verwahrung beim Nachlassgericht nehmen. Das neue Testament sollten Sie dann aber auch wieder gut verwahren.
Insbesondere um eine Anfechtung eines Testaments nach dem Tod zu vermeiden, sollten Sie als Erblasser unbedingt frühere Versionen eines Testaments vernichten. Wenn Sie beispielsweise eine Person in einer früheren Version Ihres Testaments zum Erben gemacht haben, in einer aktuelleren Version diese Person aber ausgeschlossen haben, kann das ein Motiv für die betroffene Person sein, das Testament anzufechten.
Ehepartner können jeweils ein Einzeltestament verfassen, sie können aber auch ein gemeinschaftliches Testament aufsetzen.
Der Vorteil eines Einzeltestaments ist, dass jeder Ehepartner es jederzeit ändern kann, wann und wie er möchte. Der Nachteil ist, dass er das tun kann, ohne den Ehepartner zu informieren. Das kann natürlich weitreichende Folgen im Erbfall haben.
Auch ein gemeinschaftliches Testament kann einer von beiden Partnern widerrufen – allerdings erfährt der andere dann davon. Eine besondere Form des gemeinschaftlichen Testaments und ein beliebtes Modell ist das sogenannte Berliner Testament. Diese Art des Testaments wird häufig angewandt und ist ein gutes Konstrukt, um den Ehepartner und Kinder langfristig abzusichern. Doch ein Berliner Testament birgt auch Konfliktpotenzial und ist nicht frei von Risiken. In einem weiteren Ratgeber auf biallo.de erfahren Sie alles, was Sie zum Berliner Testament wissen sollten.
Patchworkfamilien mit Stiefkindern, nicht verheiratete Partner oder Freunde kommen in der gesetzlichen Erbfolge nicht vor. Daher kann es in einigen Familien- oder auch anderen Konstellationen sinnvoll sein, ein Testament zu verfassen.
Für Patchworkfamilien kann das Thema Erben eine Herausforderung sein. Vor allem, wenn Patchwork-Elternteile auch ihren Stiefkindern etwas vererben wollen. Gerade hier ist ein Testament sinnvoll. Denn die gesetzliche Erbfolge sieht vor, dass Kinder immer nur von ihren leiblichen Eltern erben. Stiefkinder haben jedoch keinen Erbanspruch gegenüber dem Stiefelternteil. Möchte ein Stiefelternteil einen Teil seines Vermögens seinem Stiefkind hinterlassen, muss er das in einem Testament verfügen. In Patchworkfamilien ergeben sich immer wieder besondere Erbkonstellationen.
Ein Beispiel: Ein Paar heiratet und beide bringen Kinder mit in die neue Ehe. Die Mutter stirbt und es erben ohne Testament ihre leiblichen Kinder wie auch der Ehemann, also der Stiefvater der Kinder. Er erbt die Hälfte des Vermögens, die andere Hälfte die leiblichen Kinder zu gleichen Teilen. Stirbt nun der Stiefvater, geht das Erbe an seine leiblichen Kinder über. Die Kinder der zuerst verstorbenen Mutter erhalten keinen Anteil mehr. Sie haben somit einen Teil des Vermögens ihres Elternteils verloren. Wer das umgehen möchte, sollte die Erbfolge in einem Testament regeln. Der Ehepartner kann dann zum Beispiel als Vorerbe eingesetzt werden, die eigenen Kinder werden im zweiten Zuge als Nacherben eingesetzt. Mehr dazu lesen Sie auch im Abschnitt über die Wiederverheiratungsklausel beim Berliner Testament in einem weiteren Artikelauf biallo.de.
Stirbt der Ehepartner und es gibt keine Kinder, gehen viele davon aus, dass der hinterbliebene Partner automatisch Alleinerbe wird. Das ist ein Irrtum. Er erbt vielmehr nur einen Anteil. Wie viel, hängt davon ab, ob der Güterstand der Zugewinngemeinschaft gilt oder ob das Paar Gütertrennung vereinbart hat.
Dass in solchen Erbkonstellationen – Ehepaare ohne Kinder – Sprengstoff steckt, ist offensichtlich: Plötzlich muss sich die Witwe oder der Witwer mit den Schwiegereltern auseinandersetzen oder mit Geschwistern des verstorbenen Partners. So können die Miterben zum Beispiel auf ihren Erbanteil pochen, sodass unter Umständen eine Immobilie verkauft werden muss. Oder es geschieht, dass der hinterbliebene Partner plötzlich Miete an die Schwiegereltern oder die Geschwister zahlen muss. Auch Vermögen auf Bankkonten oder Geldanlagen müssen unter den Erben geteilt werden. Genauso gilt es für den persönlichen Besitz des Verstorbenen, auch dieser muss unter den Erben aufgeteilt werden. Manchmal wird um persönliche Dinge ganz besonders erbittert in Familien gestritten.
Fazit: Machen Sie ein Testament! Und lesen Sie den Biallo-Ratgeber „Erbfolge: Was passiert mit dem Nachlass, wenn keine Kinder vorhanden sind?“
Unverheiratete Paare erben gemäß der gesetzlichen Erbfolge nichts voneinander. Wer also möchte, dass der Partner zum Erben wird, muss ein Testament verfassen. Zu beachten ist, dass deutlich geringere Steuerfreibeträge gelten als für Eheleute, nämlich nur 20.000 Euro im Vergleich zu 500.000 Euro bei Ehepartnern. Das gilt auch bei Schenkungen. Soll etwa eine Immobilie auf den Partner übertragen werden, kann es sinnvoll sein, dies schon zu Lebzeiten in Form von Schenkungen zu machen, denn alle zehn Jahre darf man den Freibetrag erneut nutzen.
Sind Erben zunächst unbekannt, wird das Nachlassgericht eingeschaltet, das den sogenannten herrenlosen Nachlass verwaltet. Ein Nachlasspfleger wird eingesetzt, der zunächst mögliche Schulden aus dem Erbe begleicht, die Wohnung auflöst und nach möglichen Erben sucht. Sind keine Erben zu finden, erbt der Staat das Vermögen, sprich: das Finanzamt des jeweiligen Bundeslandes. Alleinstehende, die selbst bestimmen wollen, was mit ihrem Nachlass geschieht, müssen ein Testament verfassen. Darin können sie auch Freunde oder Institutionen zu Erben machen.
Nach einem Todesfall verfallen Angehörige oft erst einmal in tiefe Trauer, jedoch müssen trotz allem einige wichtige bürokratische Dinge abgeklärt werden. Dafür sind meistens die Erben oder ein hinterbliebener Ehepartner zuständig. Doch dabei müssen Angehörige einiges beachten.
Wie entfaltet das Testament seine Wirkung? Zentrale Anlaufstelle ist das Nachlassgericht.
Wenn Ihr Testament ohnehin beim Nachlassgericht hinterlegt ist, wird es mit dem Tod dort automatisch eröffnet. Wenn es in Ihrer Schreibtischschublade lagert, sind diejenigen, die es auffinden, verpflichtet, es an das Nachlassgericht zu leiten. Das Nachlassgericht eröffnet das Testament und schickt es den potenziellen Erben und Pflichtteilsberechtigten per Post zu. Um die Umsetzung der Inhalte des Testaments müssen sich die Erben selbst kümmern. Das überwacht das Gericht nicht. So muss zum Beispiel auch die Person, die ein Vermächtnis erhalten soll, an die Erben herantreten und dies einfordern.
Der Erbe oder die Erbin kann mit dem Testament einen Erbschein beim Nachlassgericht beantragen, der teilweise benötigt wird, um den Nachlass zu verwalten, an Bankkonten zu gelangen etc. Gibt es mehrere Erben, können sie auch jeder einen Erbschein beantragen, man kann das aber auch gemeinsam machen, was sinnvoll ist, denn jeder Erbschein kostet eine Gebühr, die sich nach dem zu vererbenden Vermögen richtet. Liegt ein notarielles Testament vor, braucht man häufig keinen Erbschein.
Wichtige Dokumente sollte man in einem Notfallordner sammeln. Dazu gehören Verträge, Verfügungen, Vollmachten und alle Informationen, die wichtig sind, damit andere in einer Notsituation alle notwendigen Dokumente griffbereit haben, um schnell dringende Dinge regeln und abwickeln können.
Es kann durchaus sein, dass Erben ihr Erbe gar nicht annehmen wollen. Das geschieht oft dann, wenn Schulden vererbt werden. Denn Erben haften für deren Tilgung. Wenn sie das Erbe ausschlagen, lässt sich das umgehen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Schulden höher als das Erbe sind. Für das Ausschlagen eines Erbes gilt eine Frist: Erben haben sechs Wochen Zeit, ab Kenntnis der Erbschaft. Verstreicht die Frist, gilt das Erbe automatisch als angenommen.
Es kann Gründe geben, ein Testament anzufechten. Etwa dann, wenn die Pflichtteilsberechtigten nicht bedacht wurden, wenn anzunehmen ist, dass das Testament gefälscht ist oder die Erblasserin oder der Erblasser dement war zum Zeitpunkt des Verfassens. Auch ein offensichtlicher Zahlendreher in der Verfügung oder aber eine Verfügung, die der Erblasser so nicht gemeint haben kann, können relevante Gründe für eine Anfechtung sein.
Eine Anfechtung richtet man an das zuständige Nachlassgericht. Es genügt eine formlose Anfechtungserklärung, die man dem Gericht übergibt. Ein Testament lässt sich erst nach dem Tod des Erblassers anfechten. Allerdings fallen für eine Anfechtung Kosten an – für das Gericht und in der Regel für den Anwalt, den man zurate ziehen sollte. Deshalb sollte man sich sicher sein, dass die Anfechtung auch erfolgversprechend ist. Es dürfen nur Erben ein Testament anfechten, die einen Vorteil daraus ziehen können. Für die Erklärung beim Nachlassgericht hat man ein Jahr lang Zeit nach Kenntnis des Anfechtungsgrundes.

 Schweden
Schweden
 Schweden
Schweden
 Deutschland
Deutschland